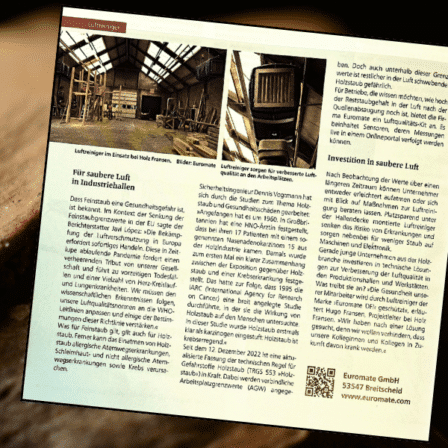Angesagt: Saharastaub. Und was sonst noch in der Luft schwebt

Atemberaubende Sonnenaufgänge. Rot gefärbter Himmel. Bilder von Städten und Landschaften mit Sepiatönung. Dicke hässliche Schlieren auf Terrassendächern, lange Schlangen vor den Autowaschanlagen und ein sandiges Gefühl im Hals. Saharastaub.
Der Saharastaub der letzten Woche hat Staub in aller Munde gebracht. Wortwörtlich. Die Luft schmeckt nach Sand und Wüste.
Ein Naturphänomen, das mehrere Male im Jahr, vor allem im Frühjahr, in Europa auftaucht. Manchmal fast unbemerkt, manchmal, wie jetzt im März, in so hoher Konzentration, dass es das Sonnenlicht filtert, den Horizont färbt und Autos, Wege, Dächer und Felder mit gelb-rötlichem Staub bedeckt.
„Der Wüstenstaub hat sowohl einen direkten als auch einen indirekten Einfluss auf die Sonneneinstrahlung“, erklärt Thomas Werner vom Deutschen Wetterdienst (DWD) in der jüngsten Ausgabe von National Geographic. „Der direkte Einfluss besteht darin, dass die Atmosphäre durch den Staub getrübt und damit die Einstrahlung am Boden reduziert wird, da die eingestrahlte Energie an den Partikeln zum Teil unmittelbar ins Weltall zurückgestreut wird.“ Saharastaub besteht aus winzig kleinen Partikeln Mineralstaubs, im Durchschnitt nur fünf bis zehn Mikrometer groß. Sie können auf eine Höhe von bis zu fünf Kilometern in die Atmosphäre aufsteigen und dort – wenn es windstill bleibt – bis zu einem halben Jahr verweilen. Kommt Wind auf, trägt dieser den Sand der Sahara um die ganze Welt. Und auf Autos, Glasdächer und Fensterscheiben.

Es ist erwiesen, dass das Einatmen von Feinstaub negativ auf den Gesundheitszustand des Menschen wirkt.
Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat in Untersuchungen festgestellt, dass es keine Feinstaubkonzentration gibt, unterhalb derer keine schädigende Wirkung zu erwarten ist.
Hierin unterscheidet sich Feinstaub von vielen anderen Schadstoffen wie Schwefeldioxid oder Stickstoffdioxid, für die man Werte angeben kann, unter denen keine schädlichen Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit zu erwarten sind.
Nicht nur kurzzeitig erhöhte Konzentrationen führen zu negativen gesundheitlichen Auswirkungen, gerade längerfristig vorliegende, geringere Konzentrationen wirken gesundheitsschädigend.
Die Feinstaubbelastung sollte also so gering wie möglich sein.
Quelle: Umweltbundesamt
Saharastaub haben wir einige Male pro Jahr. Feinstaub immer.
Saharastaub ist faszinierend und in seiner lästigen Form in der Waschanlage oder mit einem Hochdruckreiniger schnell beseitigt. Doch sind die winzigen Körnchen aus der Wüste nicht das einzige, das in der Luft herumschwebt.
Feinstaub in der Luft ist mit bloßem Auge nicht wahrzunehmen. Lediglich während bestimmter Wetterlagen kann man Feinstaub in Form einer „Dunstglocke“ sehen.
Feinstaub, die Hauptursache der Luftverschmutzung, hat zwei Quellen:
Natürliche Quellen: Dazu zählen Partikel, die von Erdumwälzungen oder Vulkanausbrüchen stammen, aber auch sogenannte marine Aerosole. Das sind flüssige oder feste Salzkristalle, die durch Emissionen des Phytoplanktons entstehen und zur Tröpfchen- bzw. Wolkenbildung in der Atmosphäre beitragen. Aerosole können über weite Strecken in der Atmosphäre transportiert werden. Feinstäube natürlicher Herkunft sind außerdem Pollen, Pilzsporen und Bakterien. Eine Gesundheitsschädigung durch geogene oder marine Partikel kann ausgeschlossen werden. Für Allergiker oder Menschen mit Heuschnupfen können hingegen Pollen, Sporen und Bakterien belastend sein.
Anthropogene Quellen: diese Aerosole entstammen im Wesentlichen dem Auspuff von Dieselmotoren, den Schornsteinen von Industrieanlagen und Kraftwerken sowie den Heizanlagen von Haushalten. Zusätzlich werden Partikel vom Bremsabrieb, Autoreifen und dem Straßenbelag freigesetzt.
Quelle: Umweltbundesamt
Entscheidend für die gesundheitliche Wirkung von Feinstaub, so das Umweltbundesamt, sind im Wesentlichen zwei Eigenschaften der Staubpartikel, die durch die Art der Quelle geprägt werden, von der sie emittiert werden.
Zum einen die Partikelgröße: Je kleiner die Staubpartikel sind, desto größer ist das Risiko zu erkranken, da sie auf Grund ihrer Größe tiefer in die Atemwege eindringen können als größere. Dadurch gelangen sie in Bereiche, von wo sie beim Ausatmen nicht wieder ausgeschieden werden. Ultrafeine Partikel können zudem über die Lungenbläschen bis in die Blutbahn vordringen und sich über das Blut im Körper verteilen. In den Lungenbläschen sind Atmung und Blutkreislauf funktionell und anatomisch sehr eng miteinander verbunden. Deshalb können Störungen des einen Systems − wie etwa entzündliche Veränderungen im Atemtrakt − auch das andere System, also Herz oder Kreislauf, beeinträchtigen.
Zum anderen die chemische Zusammensetzung der Partikel: An der Partikeloberfläche anhaftende Metalle und Halbmetalle sowie organische Komponenten (polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe = PAK, Flammschutzmittel, Pestizide) und andere Stoffe spielen hier eine Rolle.
Wenn eine Dunstglocke über Stuttgart hängt und Fahrverbote erlassen werden, ist allen klar, wie gefährlich Feinstaub in der Atemluft ist.
Doch Feinstaub hängt nicht nur in der Dunstglocke über der Stadt…
Da denkt man oft gar nicht dran: Feinstaub in Innenräumen

Was hier im Foto auf dem Hallenboden eines Verpackungsherstellers herumliegt, ist Grobstaub. Was man nicht sieht, ist der Feinstaub in der Luft.
Durch Lüften, undichte Fenster, offene Türen und Hallentore, aber auch durch Anhaftungen an Schuhen, Kleidung und Geräten gelangt die belastete Außenluft auch in Innenräume.
Im Innenraum kann die Staubkonzentration durch zusätzliche Emissionsquellen – wie Rauchen, Kerzen, Staubsaugen ohne Feinstfilter im Luftauslass, Bürogeräte, Kochen/Braten, offener Kamin sowie Abrieb, Schneid- und Schleifstaub im industriellen Bereich – vor allem der ultrafeinen Partikel, erheblich erhöht werden. Da im Innenraum weniger starke Verdünnungseffekte wirken wie in der Außenluft, ist die Feinstaubbelastung in der Innenraumluft oft höher als in der Außenluft.
In einer Stellungnahme der Innenraumhygiene-Kommission zu Feinstäuben in Wohnungen und Schulen heißt es:
„Wegen der sehr vielfältigen Quellen, aus denen Feinstaub im Innenraum stammen kann, ist eine gesundheitliche Bewertung der Feinstaubkonzentrationen sehr schwierig. Je nach Quelle des Feinstaubes im Innenraum können sich sowohl die Partikelgröße als auch die chemische Zusammensetzung des Staubes stark unterscheiden. Die Innenraumlufthygiene-Kommission geht davon aus, dass ein Teil der Wirkungen als Folge der Partikelgröße und -oberfläche, ein anderer als Folge der biologischen und chemischen Zusammensetzung des Feinstaubs auftritt. Feine und ultrafeine Partikel können bis tief in den menschlichen Atemwegstrakt eindringen. Partikel kleiner als 1-2 Mikrometer Durchmesser gelangen bis in die Lungenbläschen (Alveolen). Sehr kleine Partikel (ultrafeine Partikel < 100 nm) können von dort in den Blutkreislauf übertreten und gesundheitliche Probleme verursachen.
Haften schädliche chemische Substanzen an den Partikeln, können diese ebenfalls aufgenommen werden. Von Sonderfällen mit hoher Staubbelastung abgesehen, weiß man derzeit noch recht wenig über konkrete Gesundheitsgefahren bei Feinstaubbelastungen in Innenräumen. Quantitative Aussagen zum Gesundheitsrisiko der Feinstaubbelastungen in Innenräumen lassen sich derzeit daher nicht treffen. Die Innenraumlufthygiene-Kommission stellt fest, dass erhöhte Feinstaubkonzentrationen in Innenräumen hygienisch unerwünscht sind, ohne dass damit bereits eine konkrete Aussage zum Gesundheitsrisiko verbunden ist. Eine Verringerung der Staubkonzentrationen der Luft dient damit der Vorsorge vor vermeidbaren Belastungen.“
In Blick auf Arbeitsplätze sind die Vorgaben bezüglich Feinstaub wesentlich strenger:
Im Bezug auf Staubgrenzwerte unterscheidet man in alveolengängige(A) und einatembare(E) Stäube. Partikel mit einem Durchmesser von 10 bis 3 µm werden dabei als E-Staub bezeichnet. A-Stäube haben hingegen einen Durchmesser von unter 3 µm. Die Grenzwerte werden durch die TRGS 900 „Arbeitsplatzgrenzwerte“ definiert. Demnach gilt am Arbeitsplatz gilt für den E-Staub ein Grenzwert von 10 mg/m³. Bei dem A-Staub liegt dieser Wert bei 1,25 mg/m³.
Professionelle Staubabsauganlagen wie der DFI 8500 von Euromate unterstützen weltweit Unternehmen aus der Logistikbranche, der Verpackungsindustrie, der Holzbearbeitung, der Recyclingbranche und vielen anderen Bereichen beim Kampf gegen gesundheitsschädlichen Feinstaub.
Fragen? Wir beraten professionell und unverbindlich: Rufen Sie an – +49 2638 26 62 585 oder schicken Sie eine Mail an: info.de@euromate.com